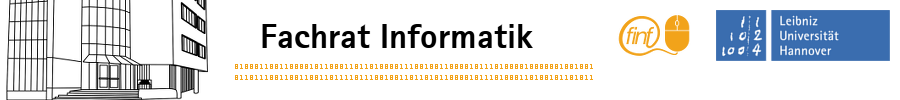Wär aber natürlich schöner, wenn es ähnlich wie in GDS ein richtiges Skript dazu gäbe.
Naja, aber wenn die Klausur wieder ähnlich wie die Testat-Klausur aussehen wird, sollte man schon ein paar Blicke auf die Folien werfen… Wobei die Übungsaufgaben für die Klausur wohl wirklich am wichtigsten sind.

Ich war da. Wir haben eigentlich hauptsächlich Fragen beantwortet, die beim durchrechnen alter Klasuren aufgetaucht sind. Da gab es immer wieder Dinge in den Lösungen die den Leuten nicht auf en ersten Blick klar waren. Alte Klausuren rechnen ist übrigens eine sehr gute Idee, und was dann noch an Fragen übrig bleibt kann man mit in die nächste Fragestunde nehmen. Die Klausuren mitsamt Lösungen findet man im Stud.IP.War eigentlich jemand in der Fragestude bei GRA?
Was wurde da besprochen?
Da wüsst ich auch keine weiteren Quellen außer den Klausur- und Übungsaufgaben samt Lösungen. Oder halt die zweite Sprechstunde kommenden Montag.
Quoted
Ich wüsste leider auch nicht wo man eine Zusammenfassung finden soll, habe eigentlich gar keine Infos in I-net zu MINI-MAX finden können
Sekunde mal, ich glaub hier liegt ein Missverständnis vor. Was genau meinst du denn mit "Datenflussdiagramm"? Bei der Minimax-Maschine gibts nämlich zwei Arten von Diagrammen die beide aus Kästchen und Pfeilen bestehen:
Quoted
Welche Fragen interessieren Dich außer Datenflussdiagramm? Bei Datenflussdiagramm steige ich selber noch nicht wirklich durch.


Der Pfeil bedeutet in der Register-Transfer-Notation einfach eine Zuweisung des enthaltenen Datums des rechts vom Pfeil stehenden Registers an das Register, welches auf der linken Seite vom Pfeil steht. In diesem speziellen Fall ist die Quelle der Adressteil des Befehls. Der komplette Befehl ist im Instruction-Register (IR) gespeichert und besteht aus 8 Bit Opcode und 24 Bit Adressteil (der angegebene Operand bei Befehlsaufruf). Mit AT sind nun also diese 24 Bit Adressteil gemeint. Der Befehl sagt nun aus, dass dieser Adressteil in das Register MAR kopiert werden soll. In diesem speziellen Zusammenhang scheint der 24 Bit Adressteil also eine Speicheradresse zu enthalten, weil ansonsten hätte es wohl keinen Sinn, ihn in das "Memory Adress Register" zu kopieren, welches i.A. nur für Speicherzugriffe genutzt wird.Ich meinte das Flussdiagramm...
Ich bin mir noch nicht ganz sicher was die einzelnen Zuweisungen bedeuten, wie z.B:
MAR <- AT , im Skript ist es zwar als "Adresse aus Adressteil des Befehls" erläutert, aber sehr weit hat mich das nicht wirklich gebracht
Dieser RT-Befehl kommt z.B. in der IFetch-Phase vor. Während der IFetch-Phase wird der vom Programm-Counter (PC) angezeigte nächste Befehl aus dem Speicher geholt und in das Instruction Register (IR) geladen. Macht also sowei Sinnoder
IR<-MDR . Werden Hier Daten in den Befehlregister geladen, irgendwie macht es für mich keinen Sinn
 Im IR steht der Befehl samt Adressteil dann während der Abarbeitung des Befehls zur Verfügung, um zB (wie oben) den Adressteil weiter zu nutzen. Etwa wie oben als Speicheradresse, oder, wie in anderen Beispielen, als zB Anzahl von geforderten Durchläufen.
Im IR steht der Befehl samt Adressteil dann während der Abarbeitung des Befehls zur Verfügung, um zB (wie oben) den Adressteil weiter zu nutzen. Etwa wie oben als Speicheradresse, oder, wie in anderen Beispielen, als zB Anzahl von geforderten Durchläufen.
sowie
M[MAR] <- MDR , bedeutet es, dass man vorhandenen Daten in das Memory Adress Register nun abspeichert?


This post has been edited 1 times, last edit by "Sunny" (Aug 21st 2008, 11:33am)
Die erste Frage vorweg, was ist Sign Extension Unit?

MAR <- AT + DEST // bestimmt man hier ab welcher Adresse man beginnen soll? Aber dann hätte man ja Quint dazu addieren müssen nicht // DEST
MAR-DEST ==0 // hier wird ja überprüft ob n=0 ist, also stellt AT in diesem Fall n dar, oder?! (Ist es denn immer so, dass man AT sich als n // vorstellen kann?)
MAR <- MAR-1 // Wenn man oben die Adresse bistimmt hat, wieso subtrahiert man jetzt? Also hab ich die erste Zuweisung komplett
missverstanden...

Die Aufgabe:
"Bevor ein Befehl ausgeführt wird, wird dieser als erstes vollständig (Opcode und Operanden)
aus dem Hauptspeicher in die CPU geladen.
Ergänzungen zur aus dem Vorlesungsskript bekannten MINIMAX-Architektur sind grau hinterlegt (s. Abbilung und Tabellen unten). Insbesondere sind ein Register DEST und eine Sign Extension Unit für das MAR-Register ergänzt worden.
S.L ALU resultB30..0@0 // Also Multiplikation mit 2
Die CPU soll verschiedene Maschinenbefehle durchführen, wobei Sie folgenden Befehl implementieren
sollen: QUINT n; (mit n: 24 bit Zahl)
Der QUINT-Befehl soll, beginnend ab der Adresse DEST im Hauptspeicher, die n ersten Werte verfünffachen "
so nun das Flussdiagramm:
"Für die Realisierung auf der Minimax-Maschine soll ein Flussdiagramm für das zu entwickelnde
Mikroprogramm erstellt werden. Vervollständigen Sie folgendes Diagramm. Der Inhalt des Registers DEST darf nicht verändert werden.
Beachten Sie den Fall n=0.
Benutzen Sie bei Ihrer Lösung die Formel 5x= 2*(2x) + x."
Die erste Frage vorweg, was ist Sign Extension Unit?
MAR <- AT + DEST // bestimmt man hier ab welcher Adresse man beginnen soll? Aber dann hätte man ja Quint dazu addieren müssen nicht // DEST
Quoted
Der QUINT-Befehl soll, beginnend ab der Adresse DEST im Hauptspeicher, die n ersten Werte verfünffachen
MAR-DEST ==0 // hier wird ja überprüft ob n=0 ist, also stellt AT in diesem Fall n dar, oder?! (Ist es denn immer so, dass man AT sich als n // vorstellen kann?)
MAR <- MAR-1 // Wenn man oben die Adresse bistimmt hat, wieso subtrahiert man jetzt? Also hab ich die erste Zuweisung komplett
missverstanden...

 GOTO IFETCH
GOTO IFETCH


wenn die Zahl klein ist z.B OP1 = 16 dann ist ja nur der
2^4 bit auf eins gesetzt und alle folgende bits sind null.
dann würde ja bei der Abfrage immer Null rauskommen
Quoted
im Schritt 5 stellt man die Adresse fest wo man das ERgebnis abspeichern soll.
6) weist man das Ergebnis den Momory Data Register zu
und schließlich in 7) speichert man das Ergebnis ab.
richtig?